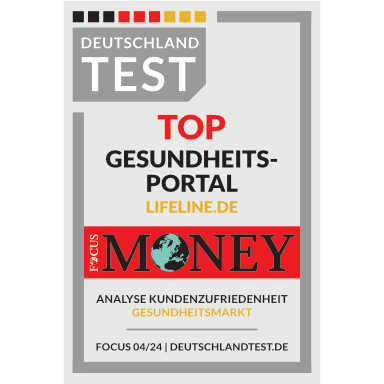Kurzsichtigkeit: Wie lässt sich eine Myopie verbessern?
Kurzsichtigkeit (Myopie) ist eine Sehstörung, bei der Objekte in größerer Entfernung unscharf wahrgenommen werden. Die Sehkraft lässt sich mit Brille oder Kontaktlinsen verbessern sowie mit Lasertherapien behandeln. Erfahren Sie mehr zu Symptomen, Ursachen und Behandlung bei Kurzsichtigkeit.
-

- © Getty Images/standret
Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten zu Kurzsichtigkeit
Wie entsteht Kurzsichtigkeit? Zu Kurzsichtigkeit kommt es, wenn das Auge einfallende Lichtstrahlen nicht auf der Netzhaut bündelt, sondern davor. Ursache ist oft ein zu langer Augapfel.
Was sind Anzeichen für Kurzsichtigkeit? Kurzsichtige Personen erkennen nahe Gegenstände problemlos, weiter entfernte sehen sie jedoch undeutlich und verschwommen. Zusätzliche Symptome sind müde, überanstrengte Augen oder Kopfschmerzen.
Ist Kurzsichtigkeit heilbar? Kurzsichtigkeit ist nicht heilbar. Sie kann aber durch Brillen und Kontaktlinsen verbessert werden. In einigen Fällen lässt sie sich durch Lasertherapie korrigieren.
Artikelinhalte im Überblick:
Was ist Kurzsichtigkeit?
Kurzsichtigkeit ist die häufigste Form der Fehlsichtigkeit, bei der Betroffene ohne Sehhilfe in der Ferne nicht scharf sehen können. Im Nahbereich hingegen kann die Sehkraft vollständig erhalten oder sogar besser sein als bei einer normalsichtigen Person.
Kurzsichtige Menschen kneifen gerne die Augenlider zusammen oder blinzeln, um Objekte oder Gegenstände in der Ferne besser erkennen zu können. Davon leitet sich der medizinische Fachbegriff Myopie ab, denn das Wort "Myops" bedeutet im Griechischen "Blinzelgesicht".
Etwa ein Drittel aller Deutschen ist kurzsichtig. Fachleute vermuten, dass die Zahl in den nächsten Jahren noch steigen wird.
Was ist kurzsichtig und was ist weitsichtig?
Die Begriffe Kurzsichtigkeit (Myopie) und Weitsichtigkeit (Hyperopie) führen oft zu Verwirrung. Denn tatsächlich verhält es sich genau umgekehrt, als man im ersten Moment denken könnte:
Kurzsichtige Menschen sehen in der Nähe gut, während sie in der Ferne unscharf sehen.
Weitsichtige Personen sehen weitentfernte Dinge klar, erkennen aber nahe gelegene Gegenstände in kurzen Entfernungen nicht scharf.
Was bedeutet Dioptrien?
Die Brechkraft des Auges wird in Dioptrien (dpt) angegeben. Für ein gesundes Auge beträgt der Normwert bei großer Entfernung etwa 60 bis 65 dpt. Die Angabe des Kurzsichtigkeitsgrads erfolgt durch negative Dioptrienwerte, beispielsweise -1,0 dpt.
Eine leichte Kurzsichtigkeit liegt zwischen 0 und -1 Dioptrien. Bei Werten darüber ist das Sehvermögen eingeschränkt und macht eine Korrekturhilfe nötig.
Ursachen von Kurzsichtigkeit
Kurzsichtigkeit ist in den meisten Fällen erblich bedingt und lässt sich allgemein auf zwei Ursachen zurückführen:
Die Achsenmyopie kommt häufiger vor. Dabei ist der Augapfel zu lang.
Bei der Brechungsmyopie wird einfallendes Licht von der Hornhaut oder der Linse zu stark gebrochen. Auch eine getrübte Linse kann die Brechkraft der Linse erhöhen.
Beide Ursachen können auch gemeinsam auftreten. Die Folgen sind stets gleich: Das Auge fokussiert einfallendes Licht nicht auf der Netzhaut, sondern ein kleines Stück davor. Objekte in relativer Nähe kann das Auge hingegen weiterhin scharf auf der Netzhaut abzubilden.
Nah- und Ferneinstellung der Augen
Das Sehen ist ein komplexer Vorgang. Lichtstrahlen, welche in das Auge einfallen, nehmen ihren Weg durch die Hornhaut, Pupille und treffen als erstes auf die Linse. Weil diese gekrümmt ist, bricht sie das Licht und bündelt es.
Die gebündelten Lichtstrahlen durchlaufen den Augapfel (Bulbus) und werfen an dessen hinterem Ende ein kleines fokussiertes Bild auf die Netzhaut. Dieses wird dann vom Sehnerv ans Gehirn weitergegeben.
Um Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung scharf fokussieren zu können, ändert die Augenlinse die Brechkraft. Dies ist durch spezielle Muskeln im Auge möglich, die Ziliarmuskeln. Ziehen sie sich zusammen, wird die Linse abgerundet und die Brechkraft erhöht, wodurch nahe Objekte erkannt werden können.
Wenn sich der Ziliarmuskel entspannt, wird die Linse flacher, was die Brechkraft verringert und das Erkennen ferner Gegenstände möglich macht. Dieser Prozess wird auch als Akkommodation bezeichnet.
-

- © Henrie – stock.adobe.com
Je nachdem wann und wie sich die Kurzsichtigkeit ausprägt, unterscheidet man folgen Arten:
Myopia simplex: Bei der "Schulmyopie" beginnt die Fehlsichtigkeit um das neunte bis 13. Lebensjahr und schreitet bis zum Erwachsenenalter weiter fort. Meist besteht nur eine schwache bis mittelgradige Kurzsichtigkeit.
Benigne Myopie: Stabilisiert sich die Kurzsichtigkeit erst um das 30. Lebensjahr mit Werten bis zu -12 dpt, so wird sie als benigne (gutartige) progressive Myopie bezeichnet.
Maligne Myopie: Die maligne Myopie (Myopia maligna, progressiva) kennzeichnet eine unbegrenzte Zunahme der Kurzsichtigkeit mit starker Überdehnung des Augapfels. Die Fehlsichtigkeit ist sehr ausgeprägt. Es kann im Verlauf zur Schädigung oder Ablösung der Netzhaut kommen.
Zu den Erkrankungen, die eine Kurzsichtigkeit begünstigen, gehören:
- Diabetes mellitus
- Augapfelprellungen, etwa durch einen Unfall
- zu hoher Augeninnendruck (Grüner Star)
- Trübung der Linse (Grauer Star)
Risikofaktoren: Das kann bei Kindern zur Kurzsichtigkeit führen
Folgende Faktoren können bei Kindern das Sehvermögen ungünstig beeinflussen:
- lange Fokussierung auf den Nahbereich, lange Naharbeit (etwa bei Nutzung von Tablets oder Smartphones)
- Lesen bei mangelnden Lichtverhältnissen
- zu wenig Sonne oder Tageslicht
- zu starke Sehhilfe mit übermäßiger Negativkorrektur
Behandlung der Kurzsichtigkeit: Brille, Kontaktlinsen oder Lasern?
Einfach und zuverlässig kann die Kurzsichtigkeit durch Brillengläser oder Kontaktlinsen ausgeglichen werden. Beide Sehhilfen haben den gleichen Effekt: Sie wirken wie eine Zerstreuungslinse und gleichen die zu starke Brechkraft des Auges aus, sodass auf der Netzhaut wieder ein scharfes Bild abgebildet wird. Die Brechkraft wird für jedes Auge einzeln angepasst.
Zum Einsatz kommen Brillen mit sogenannten Minusgläsern. Sie sind konkav geformt, das bedeutet, sie haben eine spezielle Wölbung, welche die Sehschwäche ausgleicht.
Kurzsichtigkeit heilen mit Lasertherapie
Kommen für Personen mit Myopie weder Brille noch Kontaktlinsen infrage, kann die refraktive Chirurgie helfen, die Brechkraft des Auges auf Dauer zu korrigieren.
Die Hornhaut wird dabei mit einem Laser an bestimmten Stellen abgetragen und dauerhaft abgeflacht. Dadurch vereinen sich die in das Auge einfallenden Lichtstrahlen schließlich auf der Netzhaut im Punkt des schärfsten Sehens, der sogenannten Makula.
In Abhängigkeit zur Diagnose und zum Grad der Kurzsichtigkeit stehen für eine solche refraktive Hornhautchirurgie verschiedene operative Methoden zur Verfügung. Sie heißen LASIK, LASEK oder photorefraktive Keratektomie (PRK).
Bei sehr starker Fehlsichtigkeit und Hornhautverkrümmung kann eine künstliche Linse in das Auge eingebracht werden. Die Hornhaut bleibt dabei unberührt. Die Verfahren eignen sich zur Korrektur von hochgradiger Myopie und Hyperopie sowie zur Behandlung von starker Altersweitsichtigkeit (Presbyopie).
Für wen ist Augenlasern geeignet?
Eine Augenlasertherapie ist generell nur bis zu einer bestimmten Dioptrienzahl möglich. Je nach Behandlungszentrum werden diesbezüglich Werte zwischen -6 und -10 dpt angegeben.
Generell ist der Eingriff ab 18 Jahren möglich. Daneben spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. So ist das Lasern der Augen normalerweise ausgeschlossen, wenn zum Beispiel
- chronische oder entzündliche Grunderkrankungen bestehen (etwa rheumatoide Arthritis),
- Augenerkrankungen wie ein Grauer Star vorliegen oder
- die Hornhaut keine ausreichende Festigkeit und Dicke hat.
Operationen, um Kurzsichtigkeit zu verbessern, sind zudem nicht ohne Risiko und garantieren nicht, dass nach dem Eingriff keine Sehhilfe mehr benötigt wird. Deswegen sollten sie wohl überlegt werden.
Mögliche Risiken bei Lasertherapie sind:
- erhöhte Lichtempfindlichkeit
- trockene Augen
- Infektionen
- Beeinträchtigung der Sehkraft
- Über- oder Unterkorrektur der Sehfähigkeit
Was kostet das Augenlasern?
Beim Lasern der Augen müssen Betroffene mit Kosten von etwa 1.000 bis 3.000 Euro rechnen, und zwar pro Auge. Grundsätzlich werden die Kosten für die Lasertherapie von den gesetzlichen Krankenkassen meistens nicht übernommen.
Einige private Krankenkassen kommen für die Kosten ganz oder teilweise auf. Die genauen Konditionen sind direkt bei der Krankenkasse zu erfragen.
Symptome der Kurzsichtigkeit erkennen
Häufig bemerken kurzsichtige Personen, insbesondere Kinder, ihre Sehschwäche nicht sofort. Sie fällt ihnen erst auf, wenn sie in der Schule die Schrift an der Tafel nicht mehr richtig lesen oder Straßenschilder nicht entziffern können.
Anzeichen, die für eine Kurzsichtigkeit sprechen können, sind:
- unscharfe, schlechte Sicht in der Ferne bei gleichzeitiger guter Sicht in der Nähe
- Kopfschmerzen
- müde, brennende Augen
- häufiges Zusammenkneifen der Augen oder Blinzeln bei Kindern
- Probleme bei der Fernsicht im Dunkeln, eine sogenannte Nachtblindheit oder Nachtmyopie
Kurzsichtigkeit: So stellt wird die Diagnose gestellt
Besteht der Verdacht auf eine Kurzsichtigkeit, sollte ein Besuch in einer augenärztlichen Praxis erfolgen. Zur Diagnostik bei Kurzsichtigkeit werden folgende Untersuchungen herangezogen:
Refraktometer: Mithilfe eines Refraktometers wird die Brechkraft des Auges gemessen. Betroffene schauen dafür in das Gerät hinein, die Berechnung erfolgt automatisiert innerhalb weniger Sekunden.
Sehtest: Mit verschiedenen Testlinsen und einer Testtafel mit unterschiedlich großen Buchstaben überprüft der*die Arzt*Ärztin die Sehschärfe der Person.
Des Weiteren wird der*die Augenarzt*Augenärztin nach eventuellen Folgeschäden suchen oder nach einer möglichen Ursache wie einer zugrunde liegenden Erkrankung forschen.
Verlauf: Komplikationen und Risiken bei Kurzsichtigkeit
Eine sehr stark ausgeprägte Kurzsichtigkeit kann auf lange Sicht auch Komplikationen und Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Durch den langen Augapfel kommt es zu einer starken Gewebedehnung vor allem im hinteren Teil des Augapfels. Mögliche Komplikationen bei hochgradiger Myopie sind:
- Netzhautablösung
- Makuladegeneration
- Grauer Star (Katarakt)
- Grüner Star (Glaukom)
- Glaskörpertrübung
Das Hauptrisiko bei sehr starker Myopie besteht in einer Ablösung der Netzhaut. Sie führt unbehandelt zum Erblinden, kann aber rechtzeitig erkannt sehr gut therapiert werden. Regelmäßige Kontrollbesuche in der augenärztlichen Praxis sind deshalb wichtig.
Kann man einer Kurzsichtigkeit vorbeugen?
Es gibt keine Möglichkeit, eine veranlagungsbedingte Myopie zu vermeiden. Das Ausmaß der Kurzsichtigkeit kann jedoch durch verschiedene Maßnahmen und Verhaltensregeln im Kindesalter günstig beeinflusst werden.
ausreichend Tageslicht: Lichtmangel kann die Entwicklung von Kurzsichtigkeit verstärken. Studien haben ergeben, dass im Winterhalbjahr die Kurzsichtigkeit schneller voranschreitet als im Sommer. Eltern sollten deshalb darauf achten, dass Kinder möglichst zu jeder Jahreszeit zwei Stunden täglich draußen bei Tageslicht verbringen.
gute Beleuchtung: Beim Lesen oder Schreiben immer auf ausreichend gute Beleuchtung achten.
Angemessene Korrektur: Eine frühzeitige Korrektur der Fehlsichtigkeit kann dazu beitragen, dass sich die Myopie nicht so stark ausprägt, weil dadurch die Augenmuskulatur entlastet und der Augapfel nicht zu noch stärkerem Wachstum angeregt wird. Eine übermäßige Korrektur durch zu starke Gläser wirkt sich negativ aus.
Therapie von Grunderkrankungen: Außerdem sollte versucht werden, Kurzsichtigkeit als Folge einer anderen Erkrankung durch rechtzeitige Behandlung der Grunderkrankung zu vermeiden. Insbesondere Personen mit Diabetes mellitus sollten regelmäßige Vorsorgetermine bei einem*einer Augenarzt*Augenärztin wahrnehmen.
Augentraining kann Kurzsichtigkeit nicht stoppen oder heilen
Die recht häufig anzutreffende Vorstellung, Kurzsichtigkeit könne durch bestimmte Übungen vermieden oder geheilt werden, ist in zahlreichen Studien widerlegt worden.
Weder Entspannungsübungen noch ein spezielles Training der Augenmuskulatur haben Einfluss auf die Entstehung oder die weitere Entwicklung einer Kurzsichtigkeit. Auch eine bestehende Kurzsichtigkeit lässt sich durch Augenübungen nicht verbessern oder gar wegtrainieren.